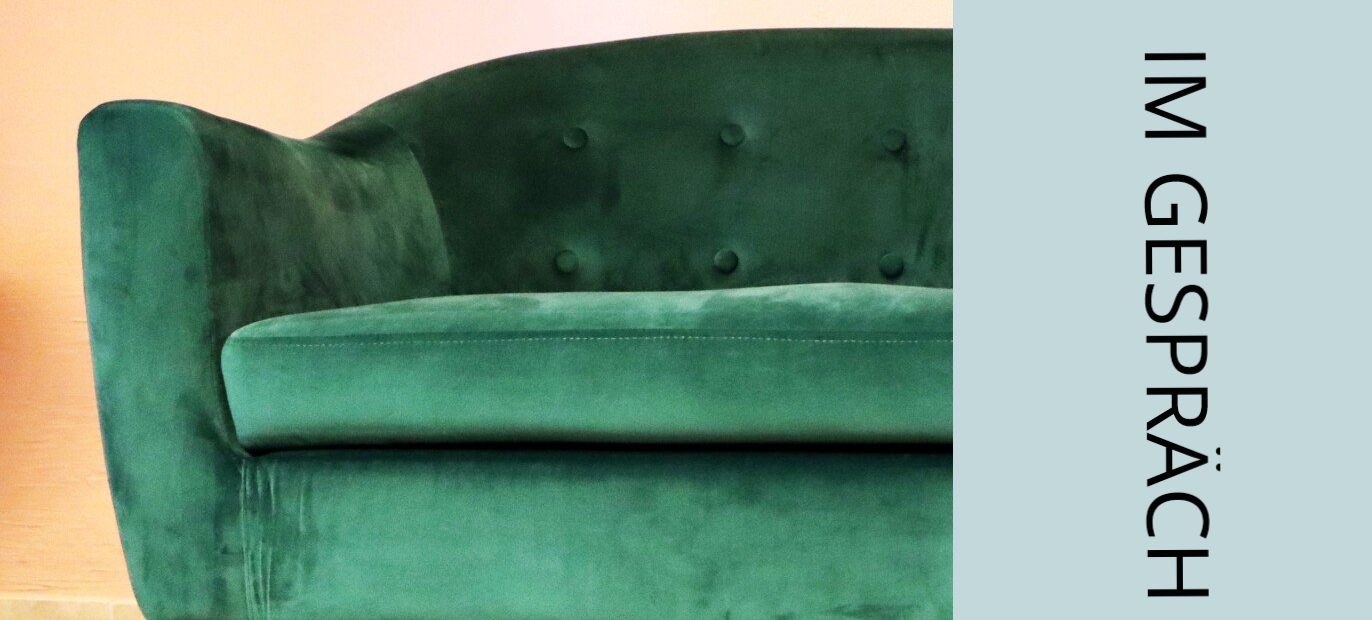Schopenhauer - ein Existenzphilosoph?
14. November 2022
Schopenhauers Wirkung auf die Geistesgeschichte ist vielfältig. Auch mit der Philosophie der Existenz wird er in Verbindung gebracht. Was spricht dafür, was dagegen? Ein Gespräch zwischen Susanne Möbuß und Daniel Schubbe.
Susanne Möbuß: Danke für die Frage. Noch bevor Schopenhauer mit der Formulierung seiner einzelnen Theorie-Elemente beginnt, macht er, finde ich, etwas absolut Faszinierendes: Er beschreibt unsere Lage im Dasein. Hier finden wir uns vor, ohne dass Grund und Sinn unseres individuellen Seins angegeben werden könnten. Der Wille in der besonderen Deutung, die ihm Schopenhauer verleiht, reproduziert sich in blindem Drang. Und was herauskommt sind wir, die „Fabrikwaare der Natur“. Wie sollten wir in Anbetracht dieser Titulierung nicht an uns zu zweifeln beginnen? Dieser Zweifel präformiert, so würde ich es zumindest sagen, das existenzphilosophische Motiv der „Geworfenheit“.
Schubbe: Ja, dieses Motiv existenzphilosophischen Denkens scheint bei Schopenhauer eine größere Rolle zu spielen. Die „Beschreibung der Lage im Dasein“ – wie Du es nennst – findet sich schließlich auch in vielen weiteren Themen seiner Philosophie, etwa wenn es um die Angst oder Langeweile oder Sinnhaftigkeit des Lebens geht. Lass mich aber bitte noch einmal kurz nachfragen, damit ich es richtig verstehe: Du würdest dieses Motiv nicht einfach als einzelnes, punktuelles Thema, sondern vielmehr dem gesamten Ansatz vorgelagert verstehen, sozusagen als Movens seines Philosophierens, oder?
Möbuß: So sehe ich es tatsächlich. Ich erinnere mich, dass Schopenhauer, als er gerade Anfang 20 war, geäußert hat: „Das Leben ist eine mißliche Sache: ich habe mir vorgesetzt, über dasselbe nachzudenken.“ Das deutet für mich auf ein noch unerklärtes Empfinden hin, dem er dann in seiner Philosophie nachspürt. Und was er dort herausfindet, gibt ihm jede nur erdenkliche Bestätigung, vor allem dadurch, dass wir Menschen, wie er sagt, die einzigen Wesen seien, die die Quelle unseres Leidens erkennen und ertragen müssen. Vielleicht könnte man eine Abstufung des Leidens annehmen: Vom empfundenen zum reflektierten Leiden und schließlich zum Leiden an der Reflexion. Oder hältst Du das für zu konstruiert? Hier erkenne ich eine ganz starke Parallele zum Existentialismus (Du weißt ja, ich versuche immer, ihn von der Existenzphilosophie zu unterscheiden). Jean-Paul Sartre beschreibt das Gefühl, dass das Sein „zuviel“ sei, und fünf Jahre später folgt seine philosophische Analyse dieses Gefühls. Und darin liegt meiner Ansicht nach ein Aspekt, der Schopenhauers Denken mit den beiden modernen Strömungen verbindet: Philosophie soll nicht vorrangig zur Klärung von Irrtümern innerhalb des Diskurses eingesetzt werden (auch wenn Schopenhauer ankündigt, „Fehler“, die Kant begangen habe, korrigieren zu wollen – was für ein Anspruch!), sondern sie soll dem Verstehen des Menschen dienen. Nenn es „pathetisch“, aber in dem Gedanken des Dienens sehe ich ein Charakteristikum des existentiellen Denkens und auch der Philosophie Schopenhauers. Es soll Denken sein, das dem Menschen dabei hilft, seine emotionale Verfasstheit im Dasein zu verstehen.
Schubbe: Es mag „pathetisch“ klingen, aber im Prinzip geht es doch um genau das: den Aufenthalt des Menschen in der Welt umfassend zu eröffnen. Nun höre ich allerdings schon die Stimmen der Kritiker*innen, die darin eine biographisch-expressive Verflachung seines Denkens wittern und auf den systematischen Anspruch seiner Philosophie verweisen. Immerhin ist Schopenhauer – und vor allem der junge – ein akademisch orientierter Philosoph, der zentrale Fragen und Probleme der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, der Logik, der Ästhetik, der Ethik und Rechtsphilosophie systematisch zu klären beabsichtigt hat, und damit zum Teil heute noch anschlussfähig ist. Für mich ist dies aber gar kein Widerspruch, sondern verweist vielmehr auf einen Stil des Philosophierens, der diese Themen in einen umfassenden Anspruch integrieren kann. Alle diese Probleme sind nicht nur akademischer Selbstzweck, sondern auch eingebettet in die menschliche Existenz. Ich denke, man kann sehr schön zeigen, wie diese Probleme von Schopenhauer in einen Zusammenhang gebracht werden, der weit über ein Problemlösungsdenken hinausgeht, ohne aber leugnen zu müssen, dass auf diesem Weg eben auch philosophische Probleme gelöst werden müssen. Das gehört zusammen. Es greift daher meines Erachtens tatsächlich viel zu kurz, existenzphilosophische oder existentialistische Motive nur in einzelnen Themen seiner Philosophie erblicken zu wollen, aber umgekehrt kann man diese größere Geste des Philosophierens bis in einzelne Kernthemen seines Denkens nachverfolgen.
Möbuß: Der Befürchtung einer solchen „Verflachung seines Denkens“, wie Du sagst, muss ich zum Glück nicht auf dem Wege der Spekulation begegnen, sondern kann mich direkt auf Schopenhauers Gedanken beziehen, die er in § 53, dem ersten des IV. Buches der „Welt als Wille und Vorstellung“ äußert. Dort bezweifelt er ja die Wirksamkeit der theoretischen Philosophie. „Denn dort, wo es den Wert oder Unwert eines Daseyns, wo es Heil oder Verdammnis gilt, geben nicht ihre toten Begriffe den Ausschlag […].“ Hier sehen wir eine atemberaubende Entschlossenheit vor uns, das Möglichkeitsspektrum von Philosophie auszuloten, und sei es auch um den Preis der Missachtung durch die Fachwelt. Wahrscheinlich ist es nichts für diese Form des Dialoges, doch es wäre nach Schopenhauers Verständnis von Philosophie zu fragen, das bei ihm in unterschiedlichen Akzentuierungen erscheint. In der modernen Existenzphilosophie kann gewissermaßen die Ernte dieser Saat eingebracht werden. Hier schreckt Karl Jaspers nicht davor zurück, sie als Denken ohne Ergebnis zu bezeichnen, weil es sich immer von Neuem zu bewähren habe. Martin Heidegger plädiert in den 1950er Jahren dafür, für unbestimmte Zeit den Rahmen der akademischen Philosophie zu verlassen, und Franz Rosenzweig, ein anderer bedeutender Wegbereiter, fordert ein „Neues Denken“, das nicht nur eine kopernikanische Wendung sei (seine Blickrichtung ist bemerkenswert), sondern „des Denkens vollkommene Erneuerung“. Von dieser Radikalität ist Schopenhauer noch weit entfernt, doch ebnet er den Weg, auf dem es dem Philosophen abverlangt wird, über die Bedeutung seines Denkens Rechenschaft abzulegen. Und hierbei wäre es fatal, wollte man die akademische gegen die existentielle Bedeutung ausspielen. Beide haben ihre absolute Berechtigung, die allerdings auf unterschiedlichen Ebenen des Selbstverständnisses angesiedelt ist. Warum fällt es uns noch immer nicht leicht, ein gleichberechtigtes Nebeneinander beider Formen anzunehmen? Der „systematische Anspruch“ in Schopenhauers Philosophie, auf den Du aus Kritiker-Sicht hinweist, steht ja völlig außer Frage. Doch heißt das nicht zwingend, dass er nicht auch ein Denken vertritt, das sich eher dem Gedanken der „Erlösung“ verpflichtet fühlt. Würden wir nur den „akademischen“ Schopenhauer kennen, würde es sich erübrigen, nach der Verbindung seines Denkens zur Existenzphilosophie zu fragen.
Schubbe: Ja, das ist eine wichtige Frage: Warum fällt es so schwer, dieses Nebeneinander anzunehmen, das ja nicht nur ein Nebeneinander ist, sondern bei Schopenhauer einen gegenseitigen Verweisungshorizont hat? Woher diese Tendenz, das eine gegen das andere zu stellen und sogar in Hierarchien zu überführen? – Ich möchte aber noch etwas bei Deiner schönen Formulierung einer „Auslotung vom Möglichkeitsspektrum von Philosophie“ verharren. Gerade in den letzten Jahren hat sich in der Schopenhauer-Forschung viel getan, das uns diesbezüglich helfen kann. Ich denke da beispielsweise an Interpretationen, die Schopenhauers Denken als Bewegung verstehen und die Figur des von ihm betonten Standpunktwechsels (Spierling) als wesentlich herausarbeiten. Es wird auch von Perspektivismus (Eschmann) gesprochen, ich selbst habe die Figur des Zwischen versucht stark zu machen. Was meines Erachtens alle diese Ansätze verbindet, ist der Versuch der Überwindung einer Linearität, eines Absolutheitsanspruches, die traditionell mit den Stichworten einer Transzendentalphilosophie oder Metaphysik verbunden sind. Schopenhauer bietet demgegenüber ein Denken an, das Betrachtungsweisen in Beziehung zueinander setzt, ja in Spannungen versetzt. Ein solches Denken übernimmt eine Verantwortung, ermöglicht es geradezu die menschliche Existenz in ihren vielfältigen Beziehungen sichtbar werden zu lassen ohne künstliche Überformung, ohne „Auflösung“, ohne „Aufhebung“. Die Orientierung an den Phänomenen des Lebens ist zentral. Da wird tatsächlich etwas auf den Weg gebracht: Du erwähnst Jaspers, Heidegger, Rosenzweig – der Name Sartres ist auch schon gefallen; was mich dabei immer wieder verwundert: Alle diese Denker hätten einen anderen Schopenhauer lesen können, aber haben ihn in der Regel doch immer weit von sich gewiesen: Hast Du dafür eine Erklärung?
Möbuß: Zumindest Franz Rosenzweig nennt Schopenhauer ja als einzigen Namen im Zusammenhang seiner neuen Auffassung von Philosophie und hebt hervor, dass er als Einziger nach dem Wert der Philosophie für den Einzelnen frage. Und das bringt mich zu einer Überlegung, die ich mit Dir teilen möchte. Wir sprechen von „der“ Existenzphilosophie und haben ein äußerst variables Gefüge heterogener Ansichten vor uns. Schauen wir uns allein die früheren Charakterisierungen etwa durch Hannah Arendt, Karl Löwith und Paul Tillich an, könnte man meinen, sie sprechen über unterschiedliche Gegenstände. Wenn wir den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, der die verschiedensten Konzeptionen trotzdem verbindet, dann sind es die Begriffe vom Einzelnen und vom Entwurf. Nicht mehr „der“ Mensch soll gedacht werden, sondern „dieser Eine“. Und mit dessen Vorstellung hängt die Frage zusammen, wie er in die Existenz finden könne. Dieser Begriff bezeichnet das verwirklichte Sein, das ein Mensch durch seinen Entwurf in das Noch-Nicht der Zukunft erreichen kann, was nach fast einhelliger Auffassung jedoch seine Separation vom Anderen erfordert. Existenz wird dann zum Ausdruck für erfülltes Selbst-Sein-Können. Wenn wir das etwa als Rahmen existentiellen Denkens annehmen, wäre es doch spannend zu überlegen, ob Schopenhauers Konzeptionen dort irgendwo nachklingen.
Schubbe: Ich bin nicht sicher, ob das gelingen wird. Sicherlich finden wir bei Schopenhauer sogar Anleitungen zum erfüllten Leben wie seine berühmten „Aphorismen zur Lebensweisheit“, aber diese sind doch weit entfernt von dem, was Du als „erfülltes Selbst-Sein-Können“ aus der Existenzphilosophie bzw. dem Existentialismus heraus beschreibst. Zwar kennt auch Schopenhauer die Unterscheidung zwischen einem vor sich hin dämmernden Leben und einem Leben, das eine größere Klarheit beispielsweise durch Kunst gewonnen hat, aber ich sehe nicht, dass dies eine zentrale Leitdifferenz für ihn wäre, die systematische Konsequenzen hat. Vermutlich zeichnet sich hier nun doch eine unterschiedliche Einschätzung ab: Meines Erachtens ist Schopenhauers Philosophie im Kern eine deskriptive Philosophie, die schlicht kein Instrumentarium dafür hat und auch nicht erwerben möchte, um den Menschen zu „sich selbst“ zu führen bzw. kommen zu lassen. Allenfalls der „erworbene Charakter“ ist bei ihm eine Figur, durch den sich der Mensch im Laufe seines Lebens in dem erkennt, was er ist, aber das heißt eben auch nur, was er prinzipiell immer schon war und auch bleiben wird. Aber vermutlich übersehe ich hier einen Punkt, den Du schon längst im Blick hattest, oder?
Möbuß: Ich würde in diesem Zusammenhang seinen Gedanken des Mitleidens stark machen. Im Grunde ist das doch die ultimative Form des Selbst-Seins, die das Eigene im Anderen findet und ihm aus dem Motiv der Gleichheit im Dasein heraus absolute Achtung schenkt. Letztlich scheint mir Schopenhauer damit schon einen Schritt weiter als die Existenzdenker zu sein, da er das Selbst eben nicht mehr in Isolation vom Anderen, sondern im Bezug zu ihm sieht. Es ist ja kein Zufall, dass es innerhalb der Existenzphilosophie so schwierig ist, Aussagen zur Ethik zu formulieren. Das Selbst ist sich dort oftmals Ziel und Inhalt der existentiellen Bewegung. Da ist Schopenhauer meiner Ansicht nach tatsächlich schon weiter, weil sich in seiner Konzeption das Selbst in allem erfasst und aus diesem Erkennen heraus zu handeln beginnt. Und dort befreit es sich, so lese ich seine Formulierungen zumindest, aus dem Diktat des Willens. Zu sich im Angesicht des Anderen zu finden – was können wir mehr erhoffen?
Schubbe: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt – und so gewendet dann weniger ein „Nachklingen“ als vielmehr eine Erweiterung, die von Schopenhauer her gedacht werden kann. Das Mitleid ist bei ihm in der Tat nicht bloß ein Gefühl, das in einem kurzen Moment auftaucht, sondern reicht viel weiter, ja erstreckt sich sogar auf bloß mögliche Leidende. Hier geht es um ein entgrenztes Selbst, die Überwindung des principium individuationis, ein Wiederfinden des Ich im Du, wobei es meines Erachtens wichtig ist, dies nicht als einen Übergang vom Ich zum Du zu verstehen, sondern vielmehr eröffnet sich im Mitleid eine besondere Situation, die eine Handlung zu bestimmen vermag – eine Situation, die sich der Verfügung entzieht. Schopenhauer also als ein Existenzphilosoph avant la lettre mit dem Potential über die Existenzphilosophie hinauszudenken? Ein interessanter Versuch. Vielen Dank für das Gespräch!
Zum Thema:

Susanne Möbuß: Existenzphilosophie. 2 Bde. Freiburg 2016. | mehr erfahren (externe Verlagsseite)
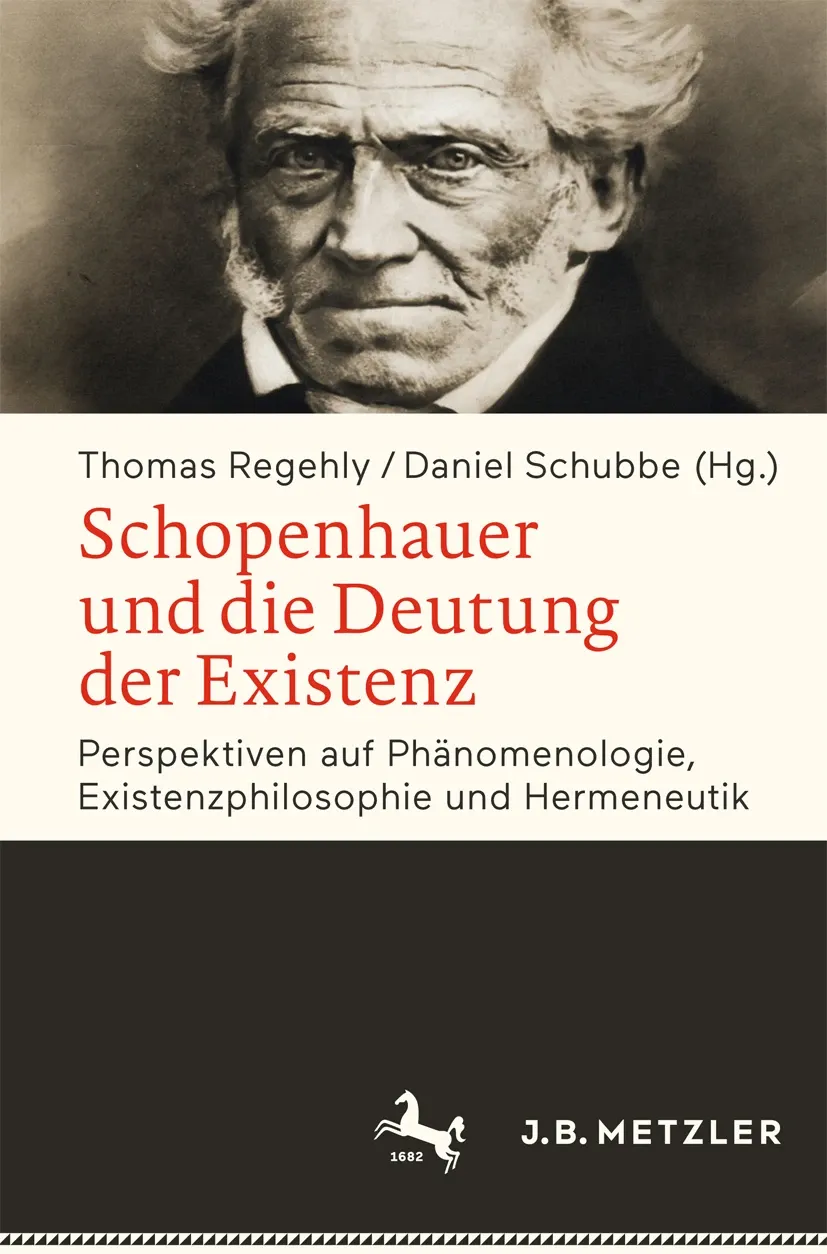
Thomas Regehly/Daniel Schubbe (Hg.): Schopenhauer und die Deutung der Existenz. Stuttgart 2016. | mehr erfahren (externe Verlagsseite)